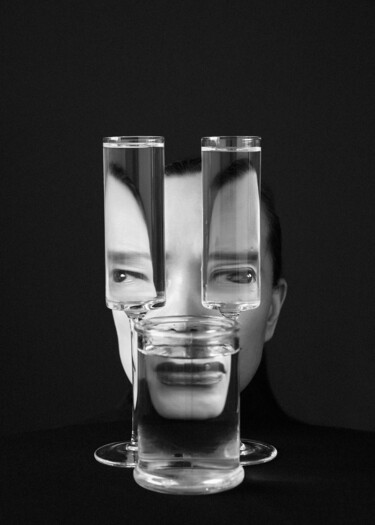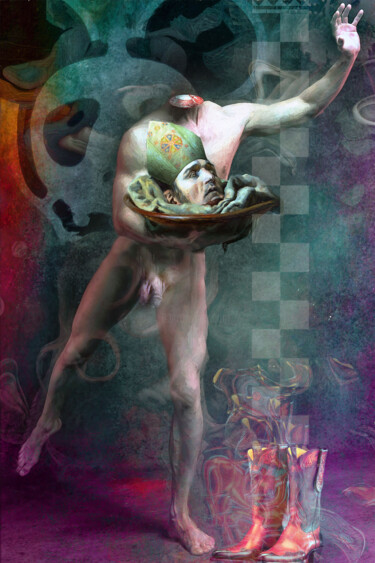Ich wusste nicht, was ich schreiben sollte, um Sie an diesem Halloween zu erschrecken, da anscheinend schon alles über furchteinflößende und beunruhigende Kunstwerke gesagt wurde. Jedes Ranking und jeder kunsthistorische Band hat die furchteinflößendsten Gemälde gründlich analysiert und jeden dunklen Aspekt untersucht. Also beschloss ich, den Kurs zu ändern und den Fokus nicht auf die Werke selbst, sondern auf das Leben der Künstler zu richten, die sie konzipiert haben. Daher habe ich eine Top-10-Liste der verstörendsten und umstrittensten Biografien der Kunstgeschichte erstellt. Tatsächlich können die problematischen Leben von Malern, die von umstrittenem Verhalten, dramatischen Ereignissen und persönlichen Kämpfen geprägt sind, genauso beunruhigend sein wie die Meisterwerke, die sie geschaffen haben. Diese Lebensgeschichten voller Spannung und Qual enthüllen den Schatten, der das kreative Genie hinter jedem Gemälde beflügelte und uns auch heute noch zutiefst beunruhigt.
Wir beginnen diese düstere Reise mit der Erkundung der Leben einiger der berühmtesten und „furchterregendsten“ Namen der westlichen Kunstgeschichte: Caravaggio, Meister des Hell-Dunkel-Malens und bekannt für sein gewalttätiges Leben; Francisco Goya, der seinen inneren Albtraum in die „Schwarzen Bilder“ übersetzte; Edvard Munch, dessen Angst und Verzweiflung sich in seinen ikonischen Werken widerspiegeln; Hieronymus Bosch, der uns surreale und beunruhigende Welten voller alptraumhafter Kreaturen hinterließ; Salvador Dalí, das exzentrische und provokative Genie; Francis Bacon, der die Realität in Porträts puren Terrors verzerrte; Vincent van Gogh, dessen tragisches Leben sich in seinen gequältesten Gemälden widerspiegelt; Gustav Klimt, ein Meister mehrdeutiger Werke, die Schönheit und Unbehagen in Einklang bringen; Frida Kahlo, die ihren körperlichen und seelischen Schmerz auf Leinwand verewigte; und Egon Schiele, dessen Werk und Leben von Intensität und Grenzüberschreitung geprägt waren.
Machen Sie sich bereit, denn Sie werden nicht nur einfache Biografien lesen. Die Struktur dieser Erzählung wird Sie dazu bringen, sich vorzustellen, wie ich diese Künstler einen nach dem anderen treffe, jeder in der Kleidung seiner Zeit, und wie sie in der ersten Person zu Ihnen sprechen ...
 Caravaggio, Medusa, 1597. Öl auf Leinwand auf Holz montiert, 60 cm × 55 cm. Uffizien, Florenz.
Caravaggio, Medusa, 1597. Öl auf Leinwand auf Holz montiert, 60 cm × 55 cm. Uffizien, Florenz.
Top 10: Die verstörendsten Biografien der Kunstgeschichte
1. Caravaggio (1571-1610)
Während ich im Tabakladen bin, kommt ein Mann in Kleidung aus dem 17. Jahrhundert auf mich zu. Ich erkenne ihn sofort: Michelangelo Merisi da Caravaggio, dasselbe gequälte Genie, das mit seinen Helldunkel- und dramatischen Kompositionen die Kunst revolutionierte. Er kommt näher, blickt mich eindringlich an und beginnt zu sprechen ...
„Ich wurde am 29. September 1571, dem Tag des Erzengels Michael, geboren. Schon in jungen Jahren war mein Leben von Tragödien geprägt. Als ich gerade sechs Jahre alt war, wütete in Mailand die Pest, und innerhalb weniger Monate verlor ich fast alle Männer meiner Familie: Mein Vater, meine Großeltern und Onkel starben einer nach dem anderen. In dieser Dunkelheit begann sich mein rebellischer und ruheloser Charakter zu entwickeln.
Mit zwölf begann ich meine Lehre in Mailand, aber meine Leidenschaft galt mehr dem Schwert als dem Fresko. Meine Hände lernten die Kunst des Duellierens ebenso schnell wie die des Pinsels. 1592 verlor ich auch meine Mutter und meinen jüngeren Bruder. Ich hatte nichts mehr, also verkaufte ich alles und verließ Mailand. Ich kam in Rom an, einer Stadt, die Reichtum versprach, aber meine rebellische Natur brachte mich bald in Schwierigkeiten.
Nicht nur meine Kunst hat mir einen Ruf eingebracht, sondern auch mein turbulentes Leben. Ich stritt, duellierte mich und tötete schließlich 1606 einen Mann in einem illegalen Duell. Von diesem Moment an war ich ein Flüchtling, der in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde. Ich floh aus Rom, zuerst nach Neapel, dann nach Malta und schließlich nach Sizilien, um meinem Urteil zu entgehen, aber selbst weit weg von der Hauptstadt fanden mich meine Feinde. Ich fand weder auf dem Schlachtfeld noch in meiner Kunst Frieden. Selbst als ich in meinen Gemälden Zuflucht suchte, tauchten die Schatten meines Lebens auf.
Sogar meine letzte Hoffnung, nach Rom zurückzukehren, um dort eine Begnadigung zu erwirken, wurde zerstört. Nach meiner Verhaftung und Freilassung überkamen mich Krankheit und Erschöpfung. Ich starb im Alter von nur 38 Jahren, ohne jemals Erlösung gefunden zu haben.“
 Francisco Goya, Saturn verschlingt seinen Sohn, 1820–1823. Öl auf Gips, auf Leinwand übertragen, 143,5 × 81,4 cm. Prado-Museum, Madrid.
Francisco Goya, Saturn verschlingt seinen Sohn, 1820–1823. Öl auf Gips, auf Leinwand übertragen, 143,5 × 81,4 cm. Prado-Museum, Madrid.
2. Francisco Goya (1746 – 1828)
Als ich an einem Cafétisch saß und in Gedanken versunken war, bemerkte ich eine Gestalt, die sich mit gemessenen Schritten näherte. Der Mann, in einen dunklen, wallenden Umhang gehüllt, hatte ein von tiefen Falten gezeichnetes Gesicht und Augen, die Geheimnisse aus einer fernen Zeit zu bergen schienen. Es war nicht nötig zu fragen, wer er war: Es war Francisco Goya, der Künstler, der mit seiner düsteren Interpretation der Realität die spanische Kunst revolutioniert hatte. Er saß neben mir ...
„Ich kam 1746 in einem kleinen Dorf namens Fuendetodos in einer Familie bescheidener Herkunft zur Welt. Meine Kindheit war einfach, aber mein wirklicher Kampf begann, als ich 1792 krank wurde und taub wurde. Dieser Moment veränderte alles. Die Welt wurde dunkler, meine Sicht auf das Leben gequälter. Mit dem Verlust des Gehörs brach auch meine Verbindung zur Realität ab und ich begann zu malen, was ich sah: nicht nur die physische Welt, sondern auch die innere, voller Ängste, Wahnsinn und Albträume.
1799 arbeitete ich an einer Serie mit dem Titel Los Caprichos . In 80 Drucken prangerte ich die Korruption, den Aberglauben und den moralischen Verfall meines Spaniens an. Es waren Karikaturen menschlichen Verhaltens, Bilder, die den Wahnsinn der Gesellschaft bloßlegten. Dies waren nicht nur Zeichnungen, sondern Ausdruck meiner wachsenden Bitterkeit und Distanz zu einer Welt, die ich nicht mehr wiedererkannte. Ich veröffentlichte sie in aller Stille und ohne großes Aufsehen, aber ich wusste, dass ihre Botschaft schwer zu ignorieren sein würde.
Als der Krieg ausbrach, hinterließ die Gewalt, der ich Zeuge wurde, tiefe Narben bei mir. Ich malte „Der 2. Mai 1808“ und „Der 3. Mai 1808“ , visuelle Zeugnisse des Schreckens und der Brutalität, die mein Land heimsuchten. Aber das war erst der Anfang. Ich suchte Zuflucht in meinem Haus, La Quinta del Sordo, und dort erweckte ich die „Schwarzen Bilder“ zum Leben, Werke voller Monster und grotesker Szenen, die meine innere Qual widerspiegelten.
Am Ende zog ich mich nach Bordeaux zurück, weit weg von meinem geliebten Spanien, aber mit dem Wissen, dass meine Kunst erhalten bleiben würde, auch wenn ich nicht mehr da wäre.“
 Edvard Munch, Der Tod und das Kind, 1889.
Edvard Munch, Der Tod und das Kind, 1889.
3. Edvard Munch (1863 – 1944)
Ich war auf dem Markt, umgeben von den leuchtenden Farben der Stände, als mir ein Mann mit düsterem Blick und steifer Haltung auffiel, der in der Nähe stand. Seine dunkle, abgenutzte Kleidung bildete einen scharfen Kontrast zur fröhlichen Atmosphäre des Ortes. Es dauerte nicht lange, bis ich ihn erkannte: Edvard Munch, der Künstler, der Angst in Kunst verwandelt hatte. Er näherte sich langsam, nahm eine der ausgestellten Orangen und begann ...
„1863 begann mein Leben in einem kleinen norwegischen Dorf namens Ådalsbruk im Schatten des Todes. Meine Mutter starb an Tuberkulose, als ich gerade fünf Jahre alt war, und nicht lange danach erlag meine Lieblingsschwester Sophie derselben Krankheit. Diese Verluste erschütterten meinen Vater, einen tief religiösen Mann, der glaubte, die Krankheiten unserer Familie seien eine Strafe Gottes. Er verfiel oft in Depressionen und sprach von spirituellen Visionen, und sein starrer Glaube und sein ständiges Schuldgefühl warfen einen Schatten auf meine Jugend.
Als Kind war ich gezwungen, mich mit Krankheit und Tod auseinanderzusetzen. Ich war oft krank, die harten norwegischen Winter hielten mich zu Hause gefangen, und so fand ich Zuflucht im Zeichnen. Mein Vater las meinen Geschwistern und mir häufig Geistergeschichten vor, insbesondere die von Edgar Allan Poe, was in mir eine tiefe Angst vor dem Tod auslöste."
Munch hält inne, sein Blick ist finster, dann fährt er fort: „Als ich 1885 Das kranke Kind malte, versuchte ich den unerträglichen Schmerz einzufangen, den ich empfand, als ich meine Schwester Sophie sterben sah. Die Kritiker zerrissen das Gemälde jedoch wegen seiner rauen und unkonventionellen Erscheinung. Damals wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass Kunst ein Schmerzensschrei sein kann.“
1908, nach Jahren der Exzesse und inneren Kämpfe, erlitt ich einen Nervenzusammenbruch. Ich war gefangen in meinen Dämonen, dem Schmerz über den Verlust meiner Mutter und Schwester, der Anspannung in meiner Seele. Ich landete monatelang im Krankenhaus und unterzog mich strenger Behandlung und Elektrotherapie. Diese Zeit hat mich tief geprägt. Doch selbst in dieser Dunkelheit fand ich einen Weg, mich auszudrücken. Damals schuf ich die Alpha- und Omega -Serie, die meine Konflikte mit Freunden und Feinden darstellt.
Fast flüsternd kommt er zu dem Schluss: „Trotz allem habe ich immer in der Gegenwart des Todes gelebt. Die letzten Jahre meines Lebens waren weniger qualvoll, aber die Erinnerung an diese Verluste, an Einsamkeit und Angst, hat mich nie verlassen. Der Schrei der Seele, den Sie in meinem berühmtesten Gemälde, Der Schrei , hören, hat nie wirklich aufgehört.“
 Hieronymus Bosch, Die Gewinnung des Steins des Wahnsinns. Prado-Museum, Madrid.
Hieronymus Bosch, Die Gewinnung des Steins des Wahnsinns. Prado-Museum, Madrid.
4. Hieronymus Bosch (1453 – 1516)
Ich war in einer alten Buchhandlung, umgeben vom Duft von Pergament und alten Büchern, als ich ihn sah. Ein Mann mit einem verstörenden Gesicht und ausweichenden Augen, in einen abgenutzten Umhang gehüllt, starrte auf ein staubiges Regal. Sein düsteres Aussehen stand in krassem Gegensatz zu der Wärme und Ruhe des Ortes. Ich bemerkte ihn, als unsere Hände nach demselben Buch griffen. Hieronymus Bosch, der Künstler, der den Albträumen der Menschheit Gestalt verlieh, strich mit seinen dünnen Fingern über den Einband und sagte zu mir ...
„Ich wurde zwischen 1450 und 1456 geboren, aber das genaue Datum bleibt ein Rätsel, wie ein Großteil meines Lebens. Meine Familie war wohlhabend, und da ich in 's-Hertogenbosch in den Niederlanden aufwuchs, erbte ich meine Leidenschaft für die Malerei von meinen Vorfahren, die eine wahre Künstlerdynastie bildeten. Als ich erst sieben oder acht Jahre alt war, wurde meine Stadt von einem Feuer heimgesucht, das etwa 4.000 Häuser zerstörte. Vielleicht war es dieses Ereignis, das die ersten Samen der höllischen Visionen pflanzte, die später meine Bilder prägen sollten.
Feuer, Zerstörung und Dunkelheit waren meine ständigen Begleiter. Ich habe immer im Schatten des Weltuntergangs gelebt. 1495 sagte ein deutscher Astrologe voraus, dass die Welt im Jahr 1524 mit einer apokalyptischen Flut untergehen würde. Dieser kollektive Schrecken beeinflusste viele Künstler, mich eingeschlossen. Mein Jüngstes Gericht und andere Werke dieser Zeit spiegelten diese Ängste wider: Teufel, böse Geister und mutierte Kreaturen bevölkerten meine Albträume und die meines Publikums.“
Während er sprach, beschrieb Bosch seinen eigentümlichen Stil weiter: „Meine Bilder zeigten nicht nur religiöse Visionen. Sie waren eine Reise ins Chaos und in die menschliche Sünde. In Der Garten der Lüste zeigte ich, wie Schönheit sich in Schrecken verwandeln kann. Groteske Kreaturen, Szenen der Verderbtheit und Monster, die aus der Dunkelheit auftauchen: All dies spiegelte den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse wider.“
Boschs Stimme wurde vertraulicher: „Natürlich gab es Gerüchte. Einige sagten, ich sei Teil einer ketzerischen Sekte, der Adamiten. Andere meinten, meine Vorstellungskraft sei durch Mutterkorn verfälscht worden, einen halluzinogenen Pilz, der das Getreide verunreinigte. Aber die Wahrheit ist viel einfacher und weitaus erschreckender: Was ich sah und malte, kam aus den Tiefen des menschlichen Geistes, einem dunklen Ort, an dem der Terror Gestalt annimmt.“
Salvador Dalí, Das Gesicht des Krieges, 1940. Olio su tela. Museum Bojimans Van Beuningen, Rotterdam.
5. Salvador Dalí (1904 – 1989)
Ich befand mich in einem surrealen Garten, umgeben von bizarren Bäumen und Blumen in unmöglichen Farben, als mir ein Mann auffiel, der von einer Aura des Mysteriösen umhüllt war. Seine Gestalt, in exzentrische Kleidung gekleidet und mit einem Hut, der wie aus einem Traum wirkte, erregte sofort Aufmerksamkeit. Es dauerte nicht lange, bis mir klar wurde, dass es Salvador Dalí war! Er näherte sich anmutig, beobachtete eine Gruppe Schmetterlinge, die in der Luft tanzten, und mit einer theatralischen Geste enthüllte er mir ...
„Ich wurde in Figueres in eine wohlhabende bürgerliche Familie hineingeboren. Mein Leben begann im Schatten des Todes, geprägt vom Verlust meines älteren Bruders, der ebenfalls Salvador hieß. Schon in jungen Jahren spürte ich die Last, als Reinkarnation dieses verlorenen Kindes angesehen zu werden, ein Gedanke, der in mir eine Reihe von Ängsten und Obsessionen auslöste, die mich mein ganzes Leben lang verfolgten. Als ich älter wurde, manifestierte sich mein Charakter in Wutausbrüchen und Frustration, Zeichen einer gequälten Seele.
Die Landschaften Kataloniens, die mich umgaben, inspirierten meine Kunst, aber mein Leben war nie einfach. Mit gerade einmal 16 Jahren erlitt ich mit dem Tod meiner Mutter ein verheerendes Trauma, ein Ereignis, das meine Seele tief vernarbte. Ihr Verlust war der „größte Schlag, den ich je erlitten hatte“. Meine künstlerische Ausbildung begann in einem Kontext der Abwesenheit und des Schmerzes, in dem die Striche meines Bleistifts versuchten, einer Welt Form zu geben, die mir, wie ich fühlte, entglitt.
1929, nach dem Bruch mit meinem Vater, der mich und meine exzentrische Persönlichkeit aus unserem Haus verbannte, begann ich, mein Leben als Einsiedler zu führen, beschränkt auf meine kreative Welt. Meine Malerei wurde von Träumen und Albträumen geprägt, wobei sich Objekte zu Interpretationen des Unterbewusstseins verzerrten. Mit meiner paranoid-kritischen Methode inszenierte ich surreale Visionen und beschäftigte mich mit Themen wie Zeit, Tod und dem eigentlichen Wesen der Existenz.
Mit Gala, meiner Muse, veränderte sich mein Alltag weiter, aber nicht ohne die Last der Besessenheit und der Angst vor dem Verlassenwerden. Die letzten Jahre waren tatsächlich von einer Depressionsspirale geprägt, die größtenteils auf ihre Krankheit und ihre Manipulation meiner Gesundheit zurückzuführen war. Mit ihrem Tod im Jahr 1982 befand ich mich erneut in der Dunkelheit. Mein Kampf mit dem Leben und der Kunst ging weiter, aber es war die Schaffung des Dalí-Theater-Museums in Figueres, mein Testament, das meiner Existenz einen letzten Sinn gab.“
Francis Bacon, Gemälde, 1946: Öl und Pastell auf Leinen, 197,8 x 132,1 cm. New York, MoMA.
6. Francis Bacon, (1909 – 1992)
Ich befand mich in einer alten Metzgerei, der metallische Geruch von Fleisch lag in der Luft, und die Haken schwangen leicht, was eine leicht beunruhigende Atmosphäre erzeugte. Zwischen den hängenden Kadavern stand Francis Bacon und wählte mit konzentriertem Blick sorgfältig Stücke aus, während der Metzger ihm Ratschläge gab. Irgendwann wandte sich Bacon mit einem fast verschwörerischen Lächeln an mich und fragte, welches Stück ich wählen würde. Bevor ich jedoch antworten konnte, begann er zu sprechen ...
„Ich wurde in Dublin geboren und trug den Namen eines berühmten Vorfahren, doch mein Leben war von Anfang an von einer Tragödie geprägt. Meine Kindheit war von ständiger Gewalt überschattet und wurde durch ein unterdrückerisches familiäres Umfeld und meine aufkommende Homosexualität geprägt. Als ich älter wurde, gipfelte die harte Behandlung durch meinen Vater in körperlicher und psychischer Misshandlung, die schließlich dazu führte, dass ich von zu Hause verwiesen wurde, weil ich es wagte, Frauenkleider zu tragen.
Da ich nirgendwo hin konnte, irrte ich zwischen London, Berlin und Paris umher, wo ich eine neue Freiheit fand, meine sexuelle Identität zu erkunden. Mein Leben wurde zu einem Karussell aus turbulenten Beziehungen und Begegnungen mit faszinierenden, aber destruktiven Männern. Meine Beziehung mit Peter Lacy, einem ehemaligen Piloten, erwies sich als besonders intensiv; unsere Abenteuer endeten in Gewalt und Chaos, aber auch in Momenten tiefer Verbundenheit.
Nach dem Krieg widmete ich mich mit neuer Leidenschaft der Malerei und verwandelte meine Leidenserfahrungen in Kunst. Jedes Gemälde wurde zu einem Spiegelbild meines Schmerzes, einer unverfälschten Darstellung meiner tiefsten Gefühle. Doch das Leben versetzte mir weiterhin verheerende Schläge, darunter den Verlust meines Geliebten George Dyer, dessen Selbstmord meine Welt erschütterte. In meinen späteren Jahren, als der Tod näher rückte, versuchte ich, mich durch den Pinsel wieder aufzubauen, doch die Schatten der Vergangenheit verließen mich nie und hinterließen mir eine tiefe Melancholie und ein komplexes Erbe.“
 Van Gogh, Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette, 1886. Öl auf Leinwand, 32,5 x 24 cm. Van Gogh Museum.
Van Gogh, Kopf eines Skeletts mit brennender Zigarette, 1886. Öl auf Leinwand, 32,5 x 24 cm. Van Gogh Museum.
7. Vincent van Gogh (1853 – 1890)
Ich stand in einem Sonnenblumenfeld, die Sonne brannte hart und die Pflanzen wiegten sich sanft im Wind. Zwischen diesen großen gelben Blüten bemerkte ich einen Mann, der über eine Staffelei gebeugt saß und völlig in seine Arbeit vertieft war. Ich wusste nicht, wer er war, aber seine Präsenz schien nahtlos mit der Umgebung zu verschmelzen. Als er mich sah, verfinsterte sich sein Gesichtsausdruck plötzlich. „Was machst du hier?“, fragte er schroff und sichtlich irritiert, als ob meine bloße Anwesenheit die Ruhe seines Augenblicks störte. Einen Moment lang überlegte ich, zu gehen, aber dann wurde sein Blick sanfter ...
„Ich bin Vincent van Gogh und mein Leben war von ständigem Leid und turbulenten Beziehungen geprägt. Ich habe nie Frieden gefunden, weder in mir selbst noch in meinen Interaktionen mit der Welt. Jahrelang kämpfte ich gegen die Armut und malte unaufhörlich, ohne wirklichen Erfolg zu haben. Ich habe in meinem ganzen Leben nur ein einziges Gemälde verkauft, ein Misserfolg, der mich aufzehrte. Ich war auf die finanzielle Unterstützung meines Bruders Theo angewiesen, der immer versuchte, mir zu helfen, obwohl ich ihm oft vorwarf, nicht genug zu tun, um meine Werke zu verkaufen.
Die Liebe war für mich ebenso schmerzhaft. Ich verliebte mich in meine Cousine Kee Vos-Stricker, aber sie wies mich ohne zu zögern ab, was zu einem Riss zwischen mir und meiner Familie führte. Später lebte ich in der Hoffnung, Trost zu finden, bei einer Prostituierten namens Sien, aber unsere Beziehung war so verzweifelt wie unser Leben. Sie war arm, krank und bereits Mutter zweier Kinder, von denen eines jung starb. Trotz allem schloss ich sie ins Herz, aber unsere Bindung vertrieb die wenigen Unterstützer, die ich hatte.
Meine psychische Instabilität war immer ein Teil von mir. Anfälle von Delirium und Depression wechselten mit kurzen Momenten der Klarheit. Während eines Wutanfalls schnitt ich mir einen Teil meines Ohrs ab, eine Geste, die den Höhepunkt meines psychischen Zusammenbruchs markierte. Ich ließ mich freiwillig in eine Nervenheilanstalt in Saint-Rémy einweisen, wo ich ironischerweise einige meiner berühmtesten Werke malte, wie etwa Sternennacht . Aber trotz meiner Kunst fand mein Geist nie Frieden.
Sogar meine Freundschaft mit Paul Gauguin wurde zu einer Quelle des Schmerzes. Wir versuchten, eine Künstlergemeinschaft zu gründen, aber unsere Beziehung geriet in Gewalt und gipfelte in einem schrecklichen Streit, der zu meiner verzweifelten Tat der Verstümmelung führte. Nachdem Gauguin mich verlassen hatte, fühlte ich mich einsamer als je zuvor.
Am Ende war die Last meiner Existenz zu schwer für mich. Ich malte weiter, Tag für Tag, aber meine Depression wurde immer schlimmer. Am 27. Juli 1890 erschoss ich mich, weil ich es nicht mehr ertragen konnte."
 Gustav Klimt, Tod und Leben, 1908-1915. Öl auf Leinwand, 180,5×200,5 cm. Leopold Museum, Wien.
Gustav Klimt, Tod und Leben, 1908-1915. Öl auf Leinwand, 180,5×200,5 cm. Leopold Museum, Wien.
8. Gustav Klimt (1862 – 1918)
Ich stand an der Bushaltestelle und beobachtete die Menschen um mich herum, während der Verkehr langsam vorbeizog. In der Menge fiel mir ein verliebtes Paar auf: Sie umarmten sich eng, waren völlig ineinander versunken, als ob die Welt da draußen nicht existierte. Dann bemerkte ich etwas weiter entfernt einen Mann, der auf einer Bank saß und ein offenes Notizbuch auf dem Schoß hatte. Er zeichnete mit überraschender Geschwindigkeit, seine Augen waren auf das Paar gerichtet. Neugierig näherte ich mich ihm und einen Moment später erkannte ich, wer er war: Gustav Klimt! Der Künstler bemerkte meinen Blick und begann, mit mir über sich zu sprechen ...
„Ich wurde in eine arme Familie hineingeboren und war von Tragödien gezeichnet. Mein Leben war von Anfang an eine Reihe schmerzhafter Ereignisse. Der frühe Tod meiner Schwester Anna, die gerade fünf Jahre alt war, war nur der Anfang. Kurz darauf brach meine Schwester Klara unter der Last religiösen Eifers zusammen, der sie in den Wahnsinn trieb. Diese Verluste sowie die ständigen finanziellen Schwierigkeiten meiner Familie beeinflussten mein Leben und meine Arbeit zutiefst. Die Kunst war mein einziger Ausweg, aber selbst dort fand ich keinen Frieden.
Als ich sowohl meinen Vater als auch meinen Bruder Ernst verlor, wurde mein Leben noch stärker erschüttert. Ernsts plötzlicher Tod an einer Herzkrankheit hinterließ eine tiefe Lücke, und ich musste nicht nur meine Mutter und Schwestern, sondern auch seine junge Witwe und ihre neugeborene Tochter unterstützen. Sein Tod verlangsamte meine Arbeit und markierte eine Zeit der Krise, die sich bis in meine künstlerische Karriere erstreckte. Die öffentlichen Aufträge, die einst meine frühe Karriere geprägt hatten, wurden zu einer Quelle der Kontroverse, die in der schmerzlichen Ablehnung meiner Arbeit durch die Universität Wien gipfelte.
Mein Privatleben war nicht weniger problematisch. Obwohl ich nie heiratete, hatte ich zahlreiche und oft turbulente Beziehungen zu Frauen, die von Klatsch und Spekulationen begleitet waren. Emilie Flöge, meine engste Vertraute, blieb an meiner Seite, aber unsere Bindung, obwohl tief, entwickelte sich nie zu einer echten romantischen Beziehung. Meine erotische Kunst, die viele auch heute noch für zu explizit halten, spiegelte vielleicht den inneren Konflikt wider, den ich durchlebte: den Wunsch, eine freie Sinnlichkeit auszudrücken, die jedoch durch die gesellschaftlichen Zwänge, unter denen ich lebte, unterdrückt wurde.
1918 erlitt ich einen Schlaganfall, der mich gelähmt zurückließ. Unfähig zu malen, versank ich in tiefer Verzweiflung. Die Grippe tat ihr Übriges und raffte mich am 6. Februar desselben Jahres dahin, während einer Pandemie, die viele der großen Wiener Künstler dahinraffte. Ich starb mit dem Gefühl, dass sich die Welt um mich herum veränderte und dass die Kunst, die ich so leidenschaftlich gelebt und geliebt hatte, schnell der Vergangenheit angehörte.“
Frida Kahlo, Die zwei Fridas, 1939. Öl auf Leinwand, 174×173 cm. Museo de Arte Moderno, Mexiko-Stadt.
9. Frida Kahlo (1907 – 1954)
Der tropische Garten schien mich mit seiner Explosion von Grün zu umhüllen, während die Blätter im Wind flüsterten und kleine Säugetiere neugierig zwischen den Zweigen herumhüpften. Inmitten der üppigen Pflanzen entdeckte ich Frida Kahlo, die auf einer Steinbank saß. Ein Affe kletterte geschickt auf ihre Schulter, während ein Vogel zierlich auf der anderen thronte, wodurch eine Szene entstand, die direkt aus einem ihrer Gemälde entsprungen zu sein schien. Ich näherte mich und bevor ich etwas sagen konnte, begann die Malerin zu sprechen ...
„Mein Leben war von Kindheit an von Schmerzen und Krankheiten geprägt, die tiefe Narben an Körper und Seele hinterließen. Mit gerade einmal sechs Jahren erkrankte ich an Kinderlähmung, was mich von anderen Kindern isolierte und eines meiner Beine deformierte, sodass ich hinkte. Doch mit achtzehn änderte sich mein Leben für immer: Bei einem beinahe tödlichen Unfall wurde ich mit einer Metallstange durchbohrt und lag bewegungsunfähig im Bett, mit mehreren Knochenbrüchen und einem Beckenbruch. Dieses körperliche Trauma brachte mich nicht nur von meinem Traum, Ärztin zu werden, ab, sondern trieb mich auch dazu, mich der Kunst zuzuwenden, um meinen Schmerz zu erforschen und zu bewältigen.
Meine Familie, fromm und streng, verstand mein inneres Leiden nicht immer. Mein Vater war jedoch einer der wenigen Menschen, zu denen ich eine besondere Bindung hatte, und er war es, der mich während meiner langen Genesung zum Malen ermutigte. Er gab mir Farben und einen Spiegel, sodass ich meine Bewegungslosigkeit in Kreativität umwandeln konnte, indem ich Selbstporträts malte, die für mich zu einem Fenster in eine Welt der Selbstbeobachtung wurden.
Mein Liebesleben war ebenso problematisch. Diego Rivera, der Mann, den ich heiratete und mit dem ich mein Herz teilte, beging schwere Verrätereien, darunter eine Affäre mit meiner Schwester Cristina. Dieser Schmerz überwältigte mich und führte dazu, dass ich Trost in anderen Beziehungen suchte, wie denen mit dem Fotografen Nickolas Muray und dem Bildhauer Isamu Noguchi, aber keine von ihnen konnte die emotionale Leere füllen, die ich in mir fühlte.
Trotz allem fand ich Zuflucht in meiner mexikanischen Identität. Ich änderte meinen Namen von Frieda zu Frida und trug stolz die traditionelle Tehuana-Kleidung, um meine Wurzeln zu umarmen und meinen verwundeten, vernarbten Körper in ein Symbol der Widerstandskraft zu verwandeln. Sogar in meinen Werken erkundete ich die Dualität meines Erbes und die Schnittstelle zwischen körperlichem Schmerz und der Schönheit meines Landes.
In meinen späteren Jahren verschlechterte sich mein Gesundheitszustand drastisch. Fehlgeschlagene Wirbelsäulenoperationen fesselten mich oft ans Bett oder den Rollstuhl. Trotzdem hörte ich nie auf zu malen und drückte meinen Kampf weiterhin durch Leinwände voller Symbolik und Leiden aus. Sogar bei meiner letzten Ausstellung, zu der ich mit dem Krankenwagen gebracht und auf ein Bett in der Mitte der Galerie gelegt wurde, war es ein Akt des Trotzes gegen die Einschränkungen meines Körpers.
Ich starb 1954 im Alter von nur 47 Jahren. Sogar mein Tod war von Geheimnissen umgeben, Gerüchte über Selbstmord kursierten. Doch bis zum Schluss blieb meine Kunst ein Schrei der Trotzreaktion, ein Spiegelbild einer Frau, die trotz ihrer Wunden nie aufgehört hat zu kämpfen.“
 Egon Schiele, Der Tod und das Mädchen, 1915. Öl auf Leinwand, 150×180 cm. Österreichische Galerie Belvedere, Wien.
Egon Schiele, Der Tod und das Mädchen, 1915. Öl auf Leinwand, 150×180 cm. Österreichische Galerie Belvedere, Wien.
10. Egon Schiele (1890 – 1918)
Der Traum zog mich in eine verzerrte Welt, erfüllt von zackigen Linien und intensiven Farben, als wäre ich direkt in ein Gemälde getreten. Während ich durch diesen surrealen Raum ging, sah ich Egon Schiele, mit seinem gequälten Blick und nervösen Haltung, wie eine der scharfen Figuren, die seine Werke bevölkerten. Ohne Vorwarnung begann er, mir all seine existenziellen Dramen zu offenbaren...
„Du weißt, mein Leben war von Verlust und Qual seit meiner Kindheit geprägt. Ich kann nicht über meine Familie sprechen, ohne an meinen Vater zu denken. Er arbeitete als Bahnhofsvorsteher, aber die Syphilis fraß ihn langsam vor unseren Augen auf. Ich war noch ein Junge, als ich sah, wie er dahinschwand, und diese Krankheit nahm ihn nicht nur, sondern verwüstete uns alle. Ich fühlte das Gewicht dieser Tragödie, als wäre es ein Fluch, der mich für immer verfolgen würde.
Nach seinem Tod wurde ich in die Obhut meines Onkels gegeben, eines kalten und distanzierten Mannes. Er verstand meine Besessenheit für Kunst nicht, hielt sie für Zeitverschwendung. Ich zeichnete, um all den Schmerz zu verstehen, aber jedes Mal, wenn ich einen Bleistift hielt, spürte ich die Kluft zwischen dem, was ich ausdrücken wollte, und dem, was die Welt bereit war zu sehen. Es war, als hätte ich eine Dunkelheit in mir, die niemand verstehen konnte.
Dann gab es Gerti, meine Schwester. Sie war die mir am nächsten stehende Person, vielleicht zu nah. Die Leute haben immer über unsere Beziehung geflüstert und Dinge insinuieren, die sie nicht verstehen können. Was wissen sie über Einsamkeit? Über das Bedürfnis, sich an jemanden zu klammern, wenn alles um dich herum zerbricht? Gerti war nicht nur meine Schwester; sie war meine Muse, mein Anker. Und deshalb war unsere Verbindung so tief, fast jenseits dessen, was als akzeptabel galt.
Trotzdem gab es einen Moment, der mich mehr geprägt hat als alles andere: meine Verhaftung im Jahr 1912. In Neulengbach beschuldigten sie mich, ein junges Mädchen entführt und verführt zu haben. Du weißt, zu dieser Zeit nutzte ich viele Kinder als Modelle, und die Gemeinde betrachtete mich mit Misstrauen. Als die Polizei in mein Atelier stürmte und meine Zeichnungen beschlagnahmte, fühlte ich mich verraten. Vor Gericht verbrannte der Richter eines meiner Werke direkt vor mir, als wollte er meine Seele mit diesem Akt auslöschen. Sie verurteilten mich nicht wegen Entführung, sondern dafür, Kinder obszönen Bildern auszusetzen. Vierundzwanzig Tage im Gefängnis... Nach dieser Erfahrung wurde meine Kunst noch dunkler, direkter. Ich konnte nicht länger ignorieren, was mich quälte.
Die Wahrheit ist, dass ich immer eine tiefe Verbindung zum Tod gefühlt habe. Selbst meine Liebe zu Wally, der Frau, die ich in Der Tod und das Mädchen malte, war ein Versuch, die Unvermeidlichkeit des Verlustes zu begreifen. Ich bereitete mich immer auf das Ende vor, und als es schließlich kam, riss es mir alles viel zu schnell weg."


 Olimpia Gaia Martinelli
Olimpia Gaia Martinelli